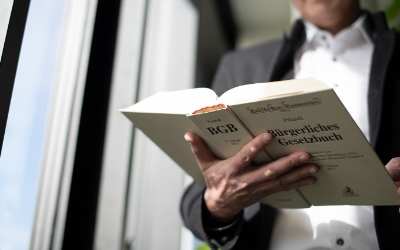Die Hinweispflicht des Arbeitgebers auf den Verfall von Urlaubsansprüchen gilt auch gegenüber (dauer)kranken Arbeitnehmern. Das entschied das ArbG Berlin mit Urteil vom 13.06.2019 unter dem Aktenzeichen 42 Ca 3229/19.
Nach § 7 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden.
Vor diesem Hintergrund verfiel nicht beantragter und deshalb nicht genommener Urlaub nach der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) grundsätzlich automatisch zum 31. Dezember des Kalenderjahres. Am 31. Dezember noch offener Resturlaub konnte ausnahmsweise bis zum 31. März des Folgejahres übertragen werden, sofern betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies zuließen. Spätestens am 31. März des Folgejahres verfiel nicht genommener Urlaub – außer bei Dauerkrankheit des Arbeitnehmers – endgültig und ersatzlos.
Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung bei dauerkranken Arbeitnehmern: Ist ein Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen an seiner Arbeitsleistung gehindert, verfallen seine gesetzlichen Urlaubsansprüche aufgrund unionsrechtskonformer Auslegung des § 7 Abs. 3 Satz 3 BUrlG erst 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres.
Das galt nach bisheriger Rechtsprechung sogar für den Fall, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber rechtzeitig, aber erfolglos aufgefordert hatte, ihm Urlaub zu gewähren. Allenfalls konnte der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber in diesem Fall Schadensersatz in Form von Ersatzurlaub verlangen.
Mit Urteil vom 19. Februar 2019 (Aktenzeichen 9 AZR 541/15) hat das BAG jedoch entschieden, dass nicht genommener Urlaub nicht mehr automatisch nach § 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz am 31. Dezember des Kalenderjahres (bzw. spätestens am 31. März des Folgejahres) verfällt, sondern in der Regel nur noch dann, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt hat und der Urlaub vom Arbeitnehmer dann trotzdem nicht genommen wurde.
Offen ließ das Urteil des BAG, ob den Arbeitgeber auch dann eine Hinweispflicht trifft, wenn der Arbeitnehmer (dauer)krank ist und somit garkeinen Urlaub nehmen kann.
Mit Urteil vom 13.06.2019 entschied das ArbG Berlin unter dem Aktenzeichen 42 Ca 3229/19, dass die vom BAG geforderte Hinweispflicht auf den Verfall von Urlaubsansprüchen auch gegenüber dauerkranken Arbeitnehmern gelten soll. Der Arbeitgeber müsse den Arbeitnehmer grundsätzlich bereits während der Krankheit – und nicht erst nach dessen Wiedergenesung – auf den Verfall am 31.12. bzw. 31.03. bzw. nach 15 Monaten klar und deutlich hinweisen. Der Umstand, dass ein arbeitsunfähiger Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch praktisch nicht verwirklichen könne, ändere nichts an der Hinweisobliegenheit des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber könne regelmäßig nicht wissen, wie lange der Arbeitnehmer erkrankt sei und, ob er den Urlaubsanspruch rechtzeitig vor dem Verfall doch noch verwirklichen könne.
Eine Ausnahme von der Hinweispflicht will das ArbG Berlin nur für den Fall erlauben, dass der Arbeitgeber von vornherein prognostizieren kann, dass der Urlaub nicht erfüllbar sein wird, weil bereits bekannt ist, dass die Arbeitsunfähigkeit für einen so langen Zeitraum fortbestehen wird, dass die 15-Monats-Frist erreicht werden wird. Die Ausnahme dürfte praktisch jedoch fast nie gegeben sein.
Faktisch hat der Arbeitgeber damit künftig immer rechtzeitig vor dem Verfall einen klaren und deutlichen Hinweis auf den Verfall des Urlaubsanspruchs nach § 7 Abs. 3 BUrlG am 31.12. des Urlaubsjahres bzw. 31.03. des Folgejahres bzw., bei dauerkranken Arbeitnehmern, zudem auf den Verfall nach 15 Monaten nach Ablauf des Urlaubsjahres, zu erteilen. Anderenfalls riskiert der Arbeitgeber, sich später nicht auf die Verfallregeln berufen zu können.
Diese Empfehlung gilt jedenfalls solange, bis das BAG höchstrichterlich dazu Stellung genommen hat, ob die Hinweispflicht auch einem dauerkranken Arbeitnehmer gilt.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: https://ssbp.de/kontakt/ !